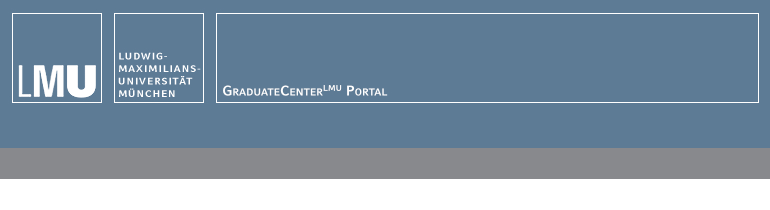Beschreibung
Zusammen mit der Rhetoriktrainerin Dr. Susanne Frölich-Steffen sprechen wir über die Disputation als eine der letzten großen Hürden im Promotionsprozess und geben Tipps, wie Promovierende die mündliche Doktorprüfung erfolgreich bewältigen können.
Transcript
Diss & Co, Episode 11: Tipps für die Disputation
Isolde von Bülow:
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Diss und Co. dem Podcast des LMU Graduate Center rund um das Thema Promotion. Mein Name ist Isolde von Bülow.
Simon Märkl:
Und ich bin Simon Märkl. Hallo. Heute sprechen wir über eine der letzten großen Hürden auf ihrem Weg zum Doktortitel, die vielen Promovierenden nach der Abgabe ihrer Dissertation noch einmal einige Nerven kostet. Die Rede ist von der Disputation.
Isolde von Bülow:
Um Ihnen ein wenig die Angst vor der Disputation, auch bekannt als Verteidigung Ihrer Dissertation, zu nehmen, wollen wir Ihnen vorstellen, was eine Disputation genau ist, wie sie typischerweise abläuft und was Sie dabei alles beachten sollten.
Simon Märkl:
Genau. Wir wollen Ihnen helfen, sich bestmöglich darauf vorzubereiten und dazu haben wir uns für später auch noch eine Expertin eingeladen, Frau Dr. Susanne Frölich-Steffen, mit der wir als Trainerin am Graduate Center regelmäßig Workshops zur erfolgreichen Bewältigung der Disputation anbieten.
Isolde von Bülow:
Mit ihr werden wir klären, warum die Disputation eine ganz besondere mündliche Prüfung ist, was Sie für das Verfahren vorbereiten und wie viel Zeit Sie selbst investieren sollten, was einen Disputationsvortrag von anderen Vorträgen unterscheidet, mit welcher Art von Fragen Sie nach dem Vortrag rechnen müssen und was es bedeutet, wenn aktuell wegen der Corona-Pandemie Disputationen in der Regel als Videokonferenzen stattfinden.
Simon Märkl:
Beginnen wir mit einer Definition. Disputation oder Verteidigung der Dissertation, was heißt das eigentlich?
Isolde von Bülow:
Nun, die Disputation oder Verteidigung der Dissertation ist eine mündliche Doktorprüfung. Ihre Doktorprüfung besteht insgesamt aus zwei Teilen. Ihrer Dissertation, also Ihrer Doktorarbeit. Die stellt den ersten, schriftlichen Teil der Doktorprüfung dar. Danach kommt als Zweites die Disputation als mündliche Doktorprüfung. Beide werden getrennt voneinander bewertet und, sofern sie beide Prüfungen bestanden haben, die Prüfungsergebnisse für die Gesamtnote ihrer Promotion wieder miteinander verrechnet.
Simon Märkl:
Ja, die Bewertungs-Skala reicht dabei von 0,5, das entspricht Summa Cum Laude, also mit Auszeichnung bestanden, über Magna Cum Laude, das ist sehr gut, Cum Laude, Gut und Rite genügend, bis 4, non sufficit, also ungenügend und daher leider nicht bestanden.
Isolde von Bülow:
Die Notenverteilung, das muss man dazu sagen, ist dabei allerdings von Gutachter zu Gutachter, Fach zu Fach und Universität zu Universität mitunter sehr unterschiedlich. Die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Bewertung ist daher umstritten.
Simon Märkl:
Es klingt kompliziert, aber die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie erst einmal zur Disputation eingeladen sind, den ersten zentralen Teil schon bestanden haben. Ihre Dissertation wurde in mindestens zwei Gutachten angenommen und Ihr Mehrwert also von der Scientific Community akzeptiert.
Isolde von Bülow:
An dieser Stelle können Sie sich dann erst mal auf die Schulter klopfen. Das Horrorszenario, das oftmals übrigens gerade diejenigen fürchten, die sehr gut sind, Stichwort Imposter-Syndrome, bei der Disputation mit vernichtender Kritik als Hochstapler oder schlimmer noch als Stümper entlarvt zu werden, ist sehr unwahrscheinlich. Entsprechend ist die Durchfallquote äußerst gering.
Simon Märkl:
Und wie läuft nun eine Disputation ab?
Isolde von Bülow:
Also bitte beachten Sie, dass die Regularien von Fakultät zu Fakultät auch unterschiedlich sein können, weshalb Sie sich unbedingt rechtzeitig über die für Sie gültige Promotions- und Prüfungsordnung informieren sollten. So ist die Disputation zwar die insgesamt häufigste Form der mündlichen Doktorprüfung. In manchen Bereichen gibt es aber auch ganz andere Formate wie ein Rigorosum oder ein Promotionskolloquium, auf die wir hier allerdings nicht näher eingehen werden.
Simon Märkl:
Genau, lesen Sie also bitte unbedingt nochmal in Ihrer Promotions- oder Prüfungsordnung nach. In der Regel halten Sie einen 15- bis 30-minütigen Vortrag zu Thesen Ihrer Dissertation. Dann fassen Sie Methoden und Ergebnisse zusammen und erläutern die wissenschaftliche Relevanz und Bedeutung der Arbeit für Ihr Fachgebiet.
Isolde von Bülow:
Ja und danach müssen Sie sich den Fragen und der Kritik der Prüfungskommission stellen. Der Prüfungskommission gehören oft Erst- und Zweit-Gutachter an. Darüber hinaus gibt es noch Prüferinnen und Prüfer von denen mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer ein anderes Fach als das Ihrer Promotion vertreten sollte. Hinzu kommen Protokollführer und gegebenenfalls Gäste oder Publikum aus der Hochschulöffentlichkeit, die allerdings kein Rederecht haben.
Simon Märkl:
Die an Ihr Referat anschließende Fachdiskussion geht vorwiegend auf Themen und Fragen ein, die sachlich oder methodisch mit der Disputation zusammenhängen. Darüber hinaus soll sie sich aber auch über angrenzende und allgemeine Themen des Promotionsverfahrens erstrecken.
Isolde von Bülow:
Dabei geht es meist nicht darum, konkrete Zahlen oder andere Fakten auswendig wiedergeben zu können, sondern vielmehr darum, Zusammenhänge erstellen und einordnen zu können. Schließlich sollen Sie zeigen, dass Sie als Wissenschaftler/Wissenschaftlerin Ihre Fachrichtung auch außerhalb Ihrer persönlichen Nische in der Breite vertreten können.
Simon Märkl:
Genau und bei der Diskussion Ihrer Doktorarbeit dürfen Sie das mit der Verteidigung dann ruhig auch wörtlich verstehen. Aber nehmen Sie es sportlich. Es ist keine Gemeinheit der Prüfungskommission, Ihre Fragestellung, Methodik, Datenauswahl, Analyse etc. kritisch zu hinterfragen. Schließlich hätte man vielleicht auch andere Entscheidungen fällen, zu anderen Schlüssen kommen können. Hier müssen Sie Ihren Standpunkt vertreten und erklären, weshalb Sie Ihre Dissertation so und ganz bewusst nicht anders geschrieben haben. Sie werden sicherlich Ihre Gründe gehabt haben.
Isolde von Bülow:
Tja, Ihre Grundhaltung sollte also sein: für Ihre Arbeit und das spezifische Thema Ihrer Dissertation sind Sie der Experte oder die Expertin. Lassen Sie sich also von den Ihnen gegenübersitzenden Professorinnen und Professoren nicht einschüchtern. Betrachten Sie die Disputation als Gelegenheit, Ihre Arbeit und deren wissenschaftliche Bedeutung für Ihr Fach einem neugierigen Publikum erklären und bestmöglich verständlich machen zu können.
Simon, sag mal, kannst du dich noch an deine Disputation erinnern?
Simon Märkl:
Ja, ich weiß vor allem noch, dass ich nachher ziemlich erleichtert war, dass zum Glück alles gut gelaufen ist. Und dafür hat es bestimmt nicht geschadet, dass ich vorher noch den Workshops „Souverän die Disputatio bewältigen“ mit Frau Dr. Susanne Frölich-Steffen am GraduateCenter besucht habe.
Isolde von Bülow
Frau Frölich-Steffen ist jetzt bei uns zu Gast im Interview und wir besprechen mit ihr weitere Tipps und wie Sie sich bestmöglich vorbereiten können.
Frau Frölich-Steffen, Sie führen seit vielen Jahren Disputations-Workshops am Graduate Center durch, vor allem für die Promovierenden aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Was würden Sie sagen, unterscheidet eine Disputation von anderen mündlichen Prüfungen?
Susanne Frölich-Steffen:
Nun, das Verfahren ist ja insofern eine Besonderheit, als es zweigeteilt ist. Wir haben einerseits den Vortrag, der sehr, sehr gut vorbereitet ist, aber dann haben wir auch den freien Frageteil. Das gleicht eigentlich fast ein bisschen einem Konferenzvortrag, den man in den Wissenschaften ja oft halten soll. Und die Disputation ist insofern … einmal, kann ich sie sehr, sehr gut beeinflussen, in dem Teil, wo ich mich vorbereite, wo ich diesen Vortrag anlege. Der andere Teil erscheint auf den ersten Blick erst mal vermeintlich unstrukturiert. Aber genau dieser vorbereitete Anteil ist eigentlich eine bestechende Chance und das unterscheidet es im Wesentlichen von anderen mündlichen Prüfungen, wo ich ja erst mal auf den ersten Blick gar keinen Einfluss auf die Prüfung habe.
Simon Märkl:
Genau, das Stichwort Vorbereitung haben Sie schon genannt. Wie sollte man sich dann konkret am besten vorbereiten auf diese Prüfung?
Susanne Frölich-Steffen:
Leider ist das schon etwas, wo man sich etwas Zeit nehmen sollte. Also es geht nicht holterdiepolter, denn es fängt damit an, dass ich mir Gedanken darüber mache, was die Erwartungshaltung der Prüfungskommission an mich ist. Die kann auch ein Stück weit differieren. Also es gibt unterschiedliche Prüfer*innen, die unterschiedliche Erwartungen an dieses Setting haben. Das hat ein bisschen mit Fachkultur zu tun, aber auch mit individuellen Erwartungshaltungen. In der Regel sagen die meisten Prüfer*innen, sie sehen sich als Critical Friend in dieser Situation. Das heißt eigentlich positiv, aber dennoch mit ein bisschen Gegenwind. Man könnte auch sagen, das ist so eine Art Initiationsritus. Man muss da durch. Und dann, wenn man sich also Gedanken darüber gemacht hat, was die Prüfer*innen erwarten könnten – und diese Gedanken können auch in einen Austausch münden, das heißt, man schreibt vielleicht mal die eine E-Mail hin und her oder man führt ein Vorbereitungsgespräch –, dann fängt man an und bereitet sich sehr, sehr intensiv auf diesen Verteidigungsvortrag vor. Denn – und das ist eben dieses große Potenzial des Verfahrens – in dem Vortrag selbst ist auch eine große Chance, die Diskussion danach ein Stück weit mit zu lenken und zu steuern, weil man ja durchaus interessante Themengebiete anreißen kann, die Potenzial für mehr haben, wenn die Prüfungszeit noch andauert, aber der Vortrag schon vorbei ist.
Isolde von Bülow:
Stichwort Zeit. Wie könnte denn ein möglicher Zeitplan aussehen? Wie viel Zeit sollte man denn in die Vorbereitung investieren?
Susanne Frölich-Steffen:
Das ist natürlich sehr individuell, wie schnell man Texte schreibt und wie schnell man die Rede fertig hat. Im Gegensatz zu unterschiedlichen anderen Verfahren und Situationen empfehle ich tatsächlich beim Disputationsvortrag ein ausformuliertes Skript zu schreiben, sofern es die Fachdisziplin zulässt. Es gibt Fachbereiche, die sehr viel freien Vortrag erwarten und in anderen ist es sogar so, dass Vorträge vorgelesen werden. Also da muss man schon ein bisschen auf die Fachkultur achten. Aber auch in den Bereichen, wo man einen sehr freien Vortrag hält, empfehle ich zumindest einmal ein Vortragsmanuskript zu schreiben, damit man sicher ist, dass man hinterher die Zielzeit von 15, 20 oder 30 Minuten, je nachdem, was die Prüfungsordnung vorsieht, genau einhalten kann. Und nun hängt es davon ab, wie schnell ich einen Vortragstext produziere. Ich würde aber in jedem Fall raten, mindestens vier Wochen vorher anzufangen, damit man diesen Vortrag in Ruhe schreiben und noch ausreichend üben kann.
Simon Märkl:
Genau. Und was ist denn dann an diesem Disputationsvortrag besonders zu beachten? Sollte man Folien haben und wenn ja, wie viele? Wie muss der Vortrag dahingehend aussehen? Was muss da alles rein?
Susanne Frölich-Steffen:
Auch hier gibt es sehr viele fachspezifische Unterschiede. Es gibt Fachbereiche – ich denke da an die Geschichtswissenschaften, zum Beispiel –, die zum Teil ganz ohne Vortragsfolien arbeiten, bei einzelnen Lehrstühlen und bei einzelnen Teilgebieten der Geschichtswissenschaft oder auch in Jura, wohingegen in anderen Fachbereichen eine Präsentation ohne Folien in der Regel nicht vorstellbar ist, in Kunstgeschichte zum Beispiel oder auch in den Wirtschaftswissenschaften, wo es sehr gängig ist, oder auch in den Naturwissenschaften, wo man häufig die Daten veranschaulicht, die man erhoben hat. Also auch da hilft der Blick auf die Fachkultur. Es ist sowieso ein hilfreicher Tipp, dass man sich vorher mal andere Disputationes anschaut. Die sind öffentlich und wenn man den Doktoranden, die
Doktoranden, den fragt, ob sie dem zustimmen, hat man in der Regel vorher schon mal Gelegenheit gehabt, so eine Disputation zu besuchen.
Also bei den Folien machen sie sich kundig, wenn sie kurz vor ihrer Disputation stehen, was von ihnen erwartet wird und natürlich, was die Daten auch hergeben. Grundsätzlich gibt es eine ganz, ganz allgemeine Regel, dass man sagt, zwei Minuten Pro Folie, das ist so ein Daumenwert, der aber natürlich zutreffen kann oder auch nicht, je nachdem, wie erklärungsbedürftig ihre Folien auch sind. Wenn Sie da nur ein Wort und Stichwort drauf haben, werden Sie nicht zwei Minuten drüber sprechen und wenn Sie sehr aufwendige Grafiken und Statistiken drauf haben, werden Sie länger brauchen.
Simon Märkl:
Ja, und wie kann ich denn auch vorsorgen oder was kann ich im Vortrag tun, um auch die Diskussion danach in meinem Sinn zu beeinflussen und sozusagen aufs richtige Gleis zu setzen?
Susanne Frölich-Steffen:
Von der Vorbereitungszeit zum fertigen Vortrag, da ist genau dieser Prozess drin, indem Sie sich überlegen: worüber möchte ich denn gerne sprechen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass Doktorand*Innen häufiger an die Vorbereitung ihrer Disputation gehen mit einem Angstgefühl. Hoffentlich werde ich das nicht gefragt und hoffentlich weist man mich auf diese Schwäche meiner Doktorarbeit nicht hin. Und das ist aus meiner Sicht die falsche Herangehensweise. Man hat sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt und ich erinnere mich noch an meine Disputation, wo ich irgendwann gedacht habe: in meinem privaten Umfeld interessiert sich schon lange kein Mensch mehr für meine Doktorarbeit. Aber diese Prüfer, die müssen mir jetzt 90 Minuten zuhören, dazu sind sie gesetzlich verpflichtet und endlich kann ich mal all das erzählen, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe. Und wenn man dahin kommt, sich zu überlegen, was möchte ich erzählen, ist man schon einen Schritt weiter. Und dann kann man das ein bisschen aufteilen und sagen, was nehme ich in den Vortrag mit rein und was hebe ich mir auf für danach. Und es ist natürlich clever, dass dann ein Stück weit auch anzudeuten, dass die Prüfer*innen Lust haben nachzufragen, was denn da noch mehr ist.
Isolde von Bülow:
Habe ich das richtig verstanden? Es ist also eine der Ideen, die Sie jetzt als Tipp weitergeben, dass man sich im Vorfeld überlegt, was könnten denn die Gutachter fragen und woran könnten sie sich reiben, um dann darauf schon im Vorfeld sich vorzubereiten und vielleicht auch Munition zu sammeln, die man dann später in der Fragerunde nutzt.
Susanne Frölich-Steffen:
Ja, auf jeden Fall, wobei ich es wahrscheinlich gar nicht als Munition bezeichnen würde, sondern eher so als bisschen … ich sage immer, es ist hilfreich, Köder auszulegen, um ein bisschen … oder das Schaufenster gut zu füllen, dass man sagt, da liegen Törtchen und ich bin sicher, dass möchte jemand haben. Und dann geht man einfach auch selber mit einem besseren Gefühl hinein. Natürlich haben die Prüfer*innen das Monopol auf die Fragen und das ist ihr gutes Recht und ihre Pflicht. Aber es schadet nicht, sich selbst darauf einzustellen. Das war toll. Das ist ein schönes Ergebnis. Das ist ein spannendes Ergebnis. Und das möchte ich erzählen. Und es ist natürlich, was Sie auch gerade gesagt haben, eine sehr, sehr gute Strategie sich vorher zu überlegen, welche Fragen könnten denn kommen und sich darauf vorzubereiten.
Simon Märkl:
Ja, da Köder auszulegen und die Diskussion zumindest zu versuchen, selber zu steuern, das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Hinweis. Und darüber hinaus, mit welcher Art von Fragen muss man denn nach dem Vortrag rechnen?
Susanne Frölich-Steffen:
Natürlich wäre ich gut bezahlt, wenn ich wüsste, welche Fragen in allen Disputationen gestellt würden, dann würde ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen. Das weiß ich also nicht. Aber es gibt ein Bündel an Fragen, das natürlich häufig gefragt wird. Also es sind sehr häufig Fragen nach dem methodischen Vorgehen. Ganz vorne dran an allen Fragen sind immer die Limitationen der Arbeit, ob man die erkennt. Wo ist der Aussagewert? Wofür kann diese Doktorarbeit stehen und wo ist sie nicht mehr aussagekräftig? Ein zweiter Bereich ist sehr häufig die Anschlussfähigkeit. Wo ist man Anschlussfähig in der Wissenschaft? Wo grenzt man sich ab? Ein drittes Thema sind häufig die sich daraus ergebenden Fragen. Was bleibt jetzt offen oder was ist jetzt vielleicht gerade neu zu hinterfragen, nachdem man diese Arbeit gelesen hat? Da gibt es häufig die Frage, wenn sie jetzt ein Sabbatical hätten, was würden sie jetzt erforschen? Das ist im Prinzip die Ouvertüre zu dem Themengebiet. Was möchten wir jetzt wissen, nachdem wir ihre Doktorarbeit gelesen haben? Weil wir jetzt erst erkennen, dass hier ein Rätsel da ist, was wir noch nicht entschlüsselt haben in der Forschung.
Isolde von Bülow:
Das klingt ja richtig spannend. Wie ist das eigentlich? Ich meine, so ein Vortrag will ja nicht nur geschrieben sein, sondern auch geübt sein. Wie ist es mit den Übungsvorträgen? Was würden Sie da als Tipp geben?
Susanne Frölich-Steffen:
Persönlich habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich der Meinung bin, man sollte diesen Vortrag ausformulieren. Einmal, damit man die Zeit bemessen kann, damit man mehr Sicherheit gewinnt. Aber man sollte dann auf keinen Fall immer dieses Manuskript ablesen und auswendig lernen, weil das natürlich sehr starr und unflexibel macht. Sondern man sollte sich zum Beispiel Stichwörter markieren und dann mit Hilfe dieser Stichwörter den Vortrag mal sprechen. Dann wieder mit dem vollständigen Skript und selbstverständlich braucht man irgendwie eine Übungsgemeinde. Ob die Familie, Freunde. Im Idealfall sind das Kollegen*innen aus dem Doktorand*innenfeld vielleicht auch ein paar, die das Verfahren schon hinter sich haben und die die Atmosphäre einmal simulieren. Ein Workshop beim Graduate Center kann da natürlich auch helfen, ein bisschen Routine in der Vorbereitung auf eine Disputation zu gewinnen.
Isolde von Bülow:
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir sind in der Corona Pandemie. Simon, das war uns auch ein Anliegen, nicht wahr?
Simon Märkl:
Genau. Ja, die allermeisten Disputationen finden seit bald zwei Jahren online statt. Da ist die Prüfungssituation des ganzen Settings ein wenig anders. Wie wirkt sich das aus? Ihrer Erfahrung nach.
Susanne Frölich-Steffen:
Ich habe noch wenig Rückmeldung darüber, was es mit den Doktorand*innen macht. Also nicht viel Rückmeldung. Was aber eigentlich auch heißt, dass ich glaube, dass es für die meisten kein so gravierender Unterschied ist, ob das online oder in Präsenz stattfindet. Es gibt natürlich persönliche Präferenzen. Die einen präsentieren Daten lieber in der Präsenz-Situation, die anderen lieber online, weil sie sich da besser fühlen im eigenen Umfeld. Also da gibt es natürlich auch persönliche Vorlieben. Was eine Mehrbelastung darstellt, ist, dass ich für die Technik geradestehen muss. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich hier zu Hause gut vorbereite oder in ein Gebäude begebe, wo ich weiß, hier habe ich ganz stabiles Internet. Meine Webcam funktioniert. Im Idealfall bereite ich auch noch ein zweites Endgerät vor. Ein iPad oder ein Laptop oder ein Handy, wo ich sage, wenn jetzt hier alle Stricke reißen, bin ich nicht aufs WLAN angewiesen, sondern kann die mobilen Daten nutzen. Und selbst wenn man selber diese Bandbreite nicht hat, findet man doch mit Sicherheit im Umfeld einen Bekannten, eine Freundin, die einem ein Gerät leihen kann oder ein Handy leihen kann, wo man sagt, hier kann ich mal ins Netz, wenn alle Stricke reißen. Ich würde das empfehlen, im Vorfeld auch auszuprobieren, vielleicht einen Probetermin mit den Prüfer*innen auszumachen oder zumindest mit der Doktor-Mutter, dem Doktor-Vater und hier einfach mal zu gucken, dass die Technik stabil steht.
Das ist eine besondere Herausforderung, dass das technisch einwandfrei läuft. Man sollte sich dann auch vorher informieren, wie das abläuft. In der Regel sollten die Prüfer*innen sich vorher darüber versichern, dass im Raum niemand anders anwesend ist. Also man muss ein Gerät haben, was man einmal durch den Raum drehen kann. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn das dann direkt während der Prüfung passiert oder der Ton ist nicht stabil, dann ist man sehr nervös. Also immer bitte vorher testen, mit Freunden, mit Bekannten und auch bitte nicht davon ausgehen, dass die Prüfer*innen alle das Perfekt technisch auf dem Schirm haben, sondern auch da Zeit einräumen, sich vielleicht eine Viertelstunde vorher schon verabreden, damit man alle technischen Probleme ausräumen kann.
Isolde von Bülow:
Und das klingt nach einem sehr, sehr wertvollen Tipp. Die Idee, das im Vorfeld nochmal auch zu besprechen, wie das laufen soll und dann auch mal zu checken, dass es läuft. Ja, vielen Dank. Genau.
Simon Märkl:
Und wenn man nun alles vergessen sollte, Frau Frölich-Steffen, was wäre der eine wichtigste Hinweis, den Sie ja promovierend nur kurz vor der Disputation unbedingt noch mitgeben wollen würden?
Susanne Frölich-Steffen:
Ich habe über die Jahre endlich verstanden und wäre dankbar gewesen, man hätte es mir gesagt, kurz vor meiner Disputation, dass Wissenschaft nicht der Ort ist, wo man für alles Antworten findet, sondern wo man neue Fragen entwickelt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man mit diesem Gefühl in eine Disputation reingeht. Es ist nicht der Ort, wo ich auf alles eine Antwort haben muss, aber wo ich die eine oder andere Frage aufwerfen kann. Und das macht es meines Erachtens erheblich leichter.
Simon Märkl:
Wunderbar. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview.
Isolde von Bülow:
Vielen Dank. Ganz fantastisch. Danke, Frau Frölich-Steffen.
Susanne Frölich-Steffen:
Ich sage auch vielen Dank.
Isolde von Bülow:
Wir sehen, mit guter Vorbereitung und der richtigen Einstellung ist die Disputation nichts, was Ihnen schlaflose Nächte bereiten muss.
Simon Märkl:
So ist es. Und wenn Sie Interesse haben an unserem Disputationsworkshop oder anderen relevanten Angeboten wie Präsentations- oder Stimmtrainings und vielen Themen mehr, dann werfen Sie einen Blick auf unser Qualifizierungsprogramm.
Isolde von Bülow:
Das war Diss und Co. zum Thema Disputation. Weiterführende Hinweise und Links sowie weitere Episoden finden Sie auf unserer Website unter www.graduatecenter.lmu.de.
Simon Märkl:
Falls Sie immer auf dem Laufenden bleiben wollen über neue Folgen, Ausschreibungen, unser Workshop-Programm und andere Veranstaltungen, können Sie dort auch gleich unseren Newsletter abonnieren. Und natürlich können Sie auch uns schreiben für Fragen oder Anmerkungen an graduatecenter.lmu.de.
Isolde von Bülow:
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Servus sagen Isolde von Bülow …
Simon Märkl:
… und Simon Märkl.